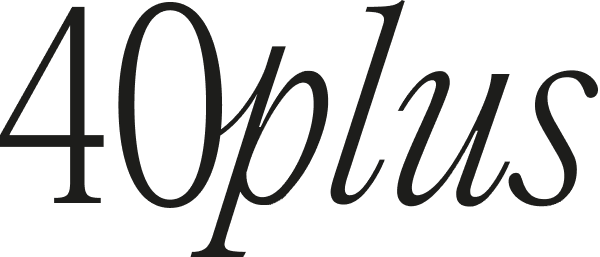Assoc. Prof. DI Dr. Barbara Siegmund ist Professorin für Lebensmittelchemie und leitet die Arbeitsgruppe Humansensorik am Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie der TU Graz. In den Forschungsarbeiten dieser Arbeitsgruppe spielt die sensorische Wahrnehmung von Geruch und Geschmack der untersuchten Produkte eine zentrale Rolle. Wein ist hier durchaus ein Thema.
Zuerst führt man den Wein an die Nase, danach kostet man ihn, schlussendlich trinkt man ihn. Diesem Ritual muss ein Wein standhalten, ansonsten hat er ein Problem, so auch der Winzer, die Wirtschaft und letztlich geht es um Verschwendung von Ressourcen. Frau Professor, wenn ein Wein bei den sensorischen Wahrnehmungen irritiert, spricht man von einem „Weinfehler“. Gibt es Möglichkeiten, Fehler frühzeitig zu korrigieren?
Prof. DI Dr. Barbara Siegmund: Der Begriff „Weinfehler“ beschreibt, wenn ein Wein sensorisch beeinträchtigt ist und nicht die Eigenschaften aufweist, die man sich vom Wein erwartet. Es gibt allerdings nicht nur einen einzigen Weinfehler, sondern eine Reihe von unterschiedlichen Weinfehlern, die sich im Wein unterschiedlich äußern und die auch unterschiedliche Ursachen haben, beginnend beim Traubenmaterial, unsachgemäßer Handhabung der Trauben, der Gärführung, ggf. Auftreten von Fehlgärungen, der Filtration, etwaige (mikrobielle) Kontaminationen durch Schläuche, Tanks oder Fässer, oxidative Prozesse während der Lagerung – hier ist das Wissen und Können im Keller gefragt, damit es nicht zur Ausbildung derartiger Fehler kommt.
Ich glaube, der populärste Weinfehler ist, wenn der Wein korkt, oder?
Prof. DI Dr. Barbara Siegmund: Richtig. Beim Weinfehler „Korkgeruch“, bei dem die Verbindung 2,4,6-Trichloranisol (TCA) über kontaminierte Korken, die als Verschlussmaterial für die Flasche verwendet werden, in den Wein gelangt. Das ist ein riesiges Problem für die Weinwirtschaft, da diese Verbindung über einen extrem niedrigen Geruchsschwellenwert verfügt. „Korkende Weine“ stellen immer wirtschaftliche Verluste dar. Die Korkproblematik ist ein Grund, warum viele Winzer:innen für Weine, die eher jung getrunken werden sollen, auf Schraubverschlüsse umgestiegen sind, um dieses Problem zu vermeiden.
Aber gerade traditionelle Länder wie Italien oder Frankreich lassen sich den Korken nicht verbieten, oder?
Prof. DI Dr. Barbara Siegmund: Im hochqualitativen/hochpreisigen Weinsegment werden nach wie vor Korken als Verschlussmaterial eingesetzt, weil der Wein in einer mit einem Naturkorken verschlossenen Flasche besser reifen kann als in einer Flasche mit Schraubverschluss. Es gibt mittlerweile Firmen, die jeden einzelnen Korken vor der Verwendung als Verschlussmaterial auf das Vorliegen von TCA analysieren, um diese Kontamination zu vermeiden.
Wenn ein Wein dennoch fehlerhaft sein sollte, gibt es verschiedene Techniken, mit denen versucht werden kann, den Fehler aus dem Wein zu entfernen (was von unterschiedlichem Erfolg gekrönt ist). Es muss aber auch gesagt werden, dass durch die Behandlungen nicht nur der Weinfehler entfernt wird, sondern meist auch viele der erwünschten Aromen des Weins verloren gehen. Manche Weinfehler, wie beispielsweise Korkgeruch, können auch nicht mehr aus dem Wein entfernt werden.
Weitere Infos zum Thema finden Sie unter:
Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie der TU Graz:
tugraz.at/institute/acfc/home
TU Graz Life Long Learning (Universitätskurs „Lebensmittelchemie und -technologie“ und Universitätskurs „Lebensmittelsensorik“)
tugraz.at/studium/studienangebot/universitaere-weiterbildung/life-long-learning-lll
Interview: Martin G. Wanko