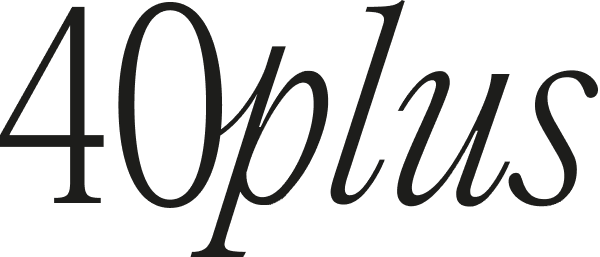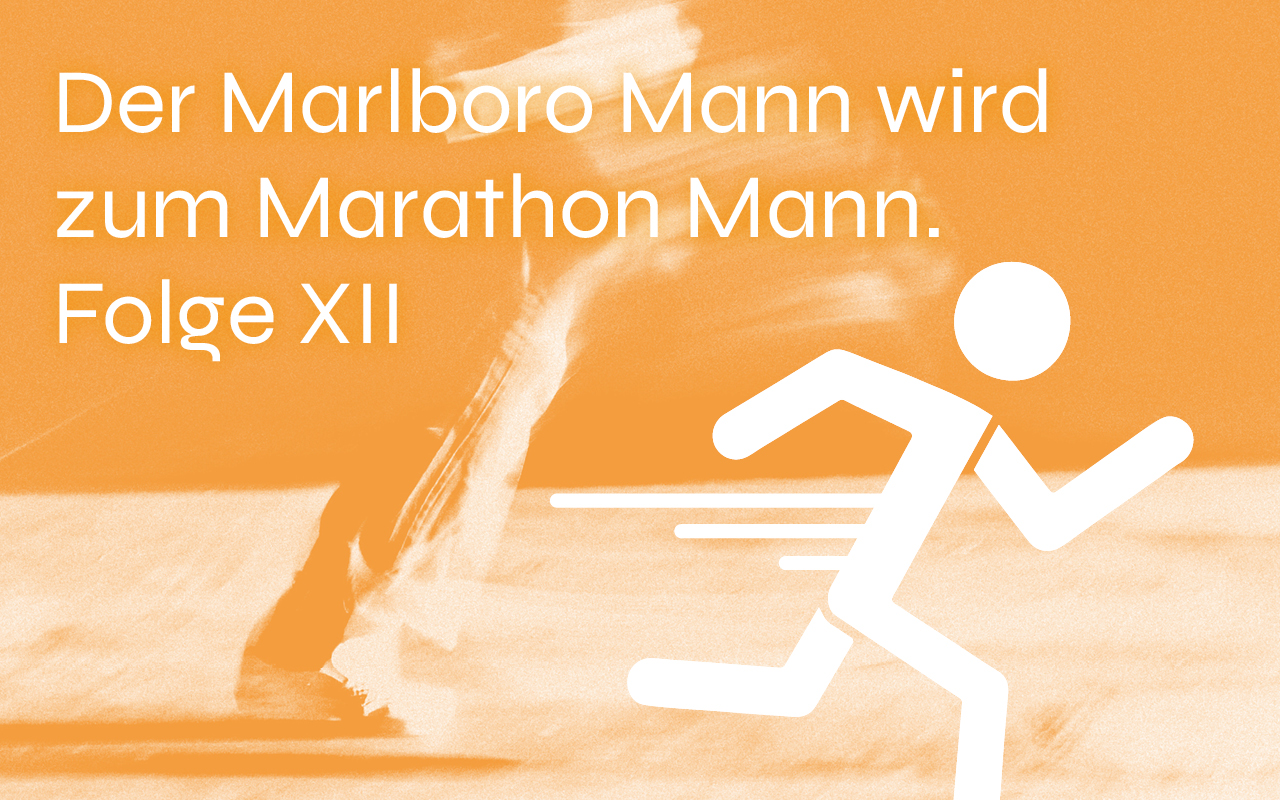Es gärt schon seit Längerem, nun wird weltweit offen darüber geredet. Der Weinkonsum geht zurück. Jedoch muss der Rückgang jetzt nicht zwingend auf jeden Winzer gleichermaßen zutreffen, dennoch ist eine Sparte im Wandel, die vor einiger Zeit noch als ein Fels in der Brandung galt. Chefredakteur Martin G. Wanko hörte sich um und fand eine sehr agile und aufgeschlossene Winzerlandschaft vor.
Die Zahlen liegen auf dem Tisch, Österreich ist ein Teilchen des internationalen Trends. „Der Weinkonsum (pro Kopf) in Österreich geht schon seit längerer Zeit zurück. Aktuell liegt er bei knapp über 26 Liter/Kopf (26,3), 2010 lag er bei 30,3 Litern, 1980 bei 34,9“, so Chris Yorke, Geschäftsführer des Österreich Wein Marketings. Die Hintergründe sind jetzt laut Yorke kein Geheimnis: „Ein verändertes, bewussteres Konsumverhalten und ein ausgeprägteres Gesundheitsbewusstsein.“ Obgleich der Handel mit 77 % und die Gastro mit 90 % Weinen aus Österreich, sich als verlässlicher Partner zeigen: Wenn in diesem Land Wein getrunken wird, dann zum Großteil aus Österreich. Aber es ändern sich eben die Gewohnheiten: Das Achterl zum Mittagessen beim Wirten um die Ecke muss es gleich weniger sein wie das Seidl Bier, der After-Work-Drink wird dem Workout im Fitnessstudio geopfert und das Pago Marille, mit Soda aufgespritzt, ist in Uni-Lokalen schon ein Klassiker. Neueste Studien besagen, dass 1/5 aller Jugendlichen in diesem Lande alkoholhaltigen Getränken voll entsagen und wiederum ein Teil ihn gezielt einsetzt.
Natürlich sind auch Winzer Realisten, Markus Huber aus Reichersdorf im Traisental meint ganz nüchtern: „Man ist derartigen gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen, ohne wirklich etwas dagegen machen zu können.“ Aber ein Hagelsturm kommt jetzt nicht aus dem Nichts, Veränderungen beginnen schleichend. Reinhold Krutzler vom Eisenberg, aus dem sonnenverwöhnten Südburgenland, zeichnet kurz diesen Weg: „Begonnen hat das 2024 im Frühsommer, da haben wir uns gefragt, was da los ist. Bei aller Vorsicht muss ich sagen, dass auf unserem Weingut alles relativ stabil ist und das bleibt auch so. Aber ich spüre, es ist was in Bewegung.“

Alles geht Richtung Qualität und Herkunft.
Philipp Grassl, aus dem niederösterreichischen Carnuntum in Göttlesbrunn, wird hier schon etwas „radikaler“, klingt aber dennoch vernünftig: „Es muss nicht schlecht sein, dass weniger, dafür besserer Wein konsumiert wird und vermutlich auch Weingärten, die historisch erst kurz, also seit den 1970ern, bewirtschaftet wurden, wieder verschwinden und die über Jahrhunderte bepflanzten besten Lagen mehr Bedeutung bekommen.“
Walter Frauwallner aus dem Vulkanland in der Südoststeiermark weiß auch, wohin es gehen sollte: „Als ich im Weingut 2001 gestartet habe, ist der Konsum bereits zurückgegangen, aber schon damals war zu sehen, alles geht in Richtung Qualität und Herkunft.“ Dem schließt sich der junge Winzer, Florian Dillinger, aus Glanz an der südsteirischen Weinstraße, gerne an: „Für unsere Kunden ist aber auch die Herkunft und das Terroir immer wichtiger. Unsere Kunden freuen sich auf Weine, die Charakter und Herkunft zeigen.“
Okay, chemisch gesehen ist Alkohol gleich Alkohol, aber dennoch fällt es einem schwer, einen biodynamischen Wein mit einem industriell gefertigten 7 Euro Wodka zu vergleichen, dazu bekommt der Trend des Nicht-Trinkens in den Sozialen Medien einen schalen Beigeschmack: „Das permanente Alkohol-Bashing, in dem überhaupt kein Unterschied zwischen Billig-Sprit und handwerklich, oft biologisch produziertem Wein, gemacht wird, der im besten Falle zum Essen konsumiert wird und weit ab eines Rauschmittel steht, kann sich als großer Nachteil herausstellen. Die landschaftliche und soziale Bedeutung der Weingüter komplett außer Acht zu lassen, wird sich leider bitter rächen“, meint Philipp Grassl aus Göttlesbrunn im Carnuntum.
Aber mittlerweile muss man, auch dank der österreichweiten Weinstraßen, nicht vom Wein alleine leben, weiß Hannes Dreisiebner aus dem Dreisiebner Stammhaus, gelegen an der südsteirischen Weinstraße in Gamlitz, zu berichten: „Im Dreisiebner Stammhaus haben wir eine Strategie gewählt, wo Weingenuss und Weintourismus vereint werden. Man kann bei uns wunderbar einen Urlaub verbringen, Wein und Kulinarik nach eigenen Wünschen erleben und genießen. So ist die Abhängigkeit geringer.“ Pragmatisch sieht es auch Thomas Taubenschuss aus dem Weinviertel in Poysdorf: „Wir merken die Marktveränderungen natürlich auch, aber man muss sich einfach neue Märkte und Kunden für seine Weine suchen.“
Stefan Krispel sieht dem Problem realistisch ins Auge: „Wein ist ein sehr traditionelles Produkt und leider bei der jungen Generation nicht angesagt. Die Herausforderung besteht darin, Traditionen zu bewahren und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben, um auch das junge Publikum zu begeistern.“
Wird der Wein leichter?
Aber nach wie vor gilt das in vielen Heurigen mal verkitscht, mal ehrlich dargebotene Wiener Lied: „Es wird a Wein sein, und mir wer’n nimmer sein…“ also wird’s auch weitergehen. Einen möglichen Weg zeichnet Chris Yorke vor: „Weine mit weniger Alkohol liegen aktuell im Trend. Das hat unterschiedliche Gründe und hängt unter anderem mit einer Veränderung der kulinarischen Vorlieben zusammen – denn auch leichtere Küchenstile sind aktuell sehr gefragt. Aber auch der Klimawandel spielt hier sicherlich eine Rolle, da man bei wärmeren Temperaturen lieber zu einem frischeren Wein greift.“
Beim Befragen der Winzer bekommt man nicht das Gefühl, dass sie etwas nachlaufen, maximal ihren Weg verfeinern. „Wichtig ist, dass wir den qualitativen Weg handwerklicher Weine weitergehen“, antwortet Walter Frauwallner und spricht so allen Qualitätswinzern aus dem Herz. Gernot Heinrich, aus dem Wein-Mekka Gols nahe dem Neusiedlersee, hebt den Unterschied hervor: „Je individueller, unverwechselbarer und authentischer die Weine in ihrer Machart und Herkunft sind, desto mehr Aufmerksamkeit erregt man und desto größer sind auch die Chancen, sich langfristig zu etablieren.“
Einen geringeren Alkoholgehalt in der Flasche zu haben, ist manchen dennoch ein Anliegen. Für Philipp Grassl ist es ein wichtiger Punkt, der vor allem durch die biodynamische Bewirtschaftung gefördert wird. „Durch die frühere physiologische Reife ist ein geringerer Alkoholgehalt im fertigen Wein möglich.“ Für Gregor Nimmervoll liegt der Schlüssel sicherlich in der Vitalität & Balance der Weingärten. „Gute physiologische Reife bei moderatem Zuckergehalt muss das Ziel sein, dafür arbeiten wir das ganze Jahr in unseren Weingärten.“ Florian Masser sieht hier die Lage seiner Weingärten als Vorteil: „Diese Produkte liegen im Fokus, vor allem in der Südsteiermark als cool-climate Region können wir da unsere Karten auf den Tisch legen.“
Stefan Krispel versucht hier möglichst viele Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen: „Hier ist ein Umdenken in der Bewirtschaftung der Weingärten notwendig, um die klimatischen Veränderungen zu berücksichtigen und volle physiologische Reife bei gleichzeitig geringem Zuckergehalt zu erreichen. Dies erfordert mehr Handarbeit im Weingarten, man wird jedoch mit leichteren und zugleich intensiven Weinen belohnt.“
„Die Weine aus der Weinregion Südsteiermark sind in der Regel eher leichte Weine“, bestätigt Hannes Dreisiebner. Jedoch bei so viel Ernst, gehört auch ein bisschen Spaß rein: „Wein ist ja auch Unterhaltung und manchmal wird eine Weinverkostung zum Kabarett“, bringt es Hannes Dreisiebner auf den Punkt, indem er den Gästen augenzwinkernd erklärt: „Dann sind Weine bis 11,5 % für mich alkoholfreie Weine, Weine zwischen 11,5 und 13 % leichte Weine und Weine über 13 % sind dann Weine.“ Man kann auch einige Male tief durchatmen und das Leben so nehmen wie es ist, denn bald ist der Sommer da und der Burgenländer Winzer Michael Schwarz, mitten aus der burgenländischen Puszta, weiß, dass das Gros der Leute „frische Weißweine und frisch fruchtige Rotweine will, die man wunderbar leicht gekühlt zum Grillen genießen kann.“
Gernot Heinrich kommt in diesem Zusammenhang auf den Rosé zu sprechen: „Der Rose macht es möglich, den Alkoholgehalt zu reduzieren. Wir produzieren auch Pet Nat, einen natürlichen Schaumwein mit nur 10 % Alkohol, mit großem Erfolg und auch hoher Exportquote.“ Natürlich ist es immer eine Frage der Lage, auch für Tom Dockner: „Da das Traisental zu den kühlsten Gebieten zählt, sind wir froh, charaktervolle, leichte Weine produzieren zu können. Auch die Kalk-Konglomerat-Geologie hilft uns dabei, mit Frische und Eleganz zu brillieren. National wie international merken wir verstärkt die Nachfrage nach leichteren Weinen mit Tiefgang.“ Die Ziele sind für Walter Frauwallner klar definiert: „Weine mit geringerem Alkoholgehalt und guter Komplexität, das ist die große Herausforderung in der Zukunft.“
Aber man muss eben nicht trendy sein – das ist der Vorteil in der großen Vielfalt im österreichischen Wein, wie man zum Beispiel von René Pöckl hört: „Das Weingut Pöckl steht für eine ganz bestimmte Weinstilistik. Wir haben nie Trends verfolgt und hatten nie ein Lifestyle-Produkt, deshalb sind unsere Verkaufszahlen stabil. Unsere Weine sind für Leute, die wissen, was sie wollen. Diesen Weg werden wir in Zukunft verfolgen und ausnahmslos Weine produzieren, die zu unserer Stilistik passen.“ Reinhold Krutzler schließt knackig ab: „Qualität hält Kunden.“

Fokus, Trend und Bio.
Wie geht’s weiter? Es muss vorausgeschickt werden, dass Wein ja nicht im Rhythmus der Vierjahrespläne gedeiht, sondern der Winzer das Zeitvolumen eines Vierteljahrhunderts anberaumen muss. Genau diese Zeit braucht eine Rebe, um sich zu entwickeln. Erst dann kommen die dichten Aromen des Terroirs zur Geltung. Um schlussendlich als Alte Rebe vinifiziert zu werden, ist der Rebstock dann schon 35 Jahre alt und älter. So widersprechen sich natürlich Trends und langfristiges Denken, aber dennoch bewegt sich etwas weiter, sonst hätte es auch im letzten Jahrhundert keine Entwicklung gegeben. Das Umdenken zu biologischem Wein ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da hier nicht die Rebe geopfert, sondern die Arbeit im Weingut verändert wird.
Foto: (c) Martin G. Wanko
„Sortentypische, saftige Trinkweine, die ihre Region widerspiegeln, sind immer im Trend. Der Trend geht eindeutig in Richtung leichterer Weine“, erklärt Stefan Krispel, dem die Qualität einer jeden Flasche Wein, unabhängig der Produktkategorie, wichtig ist: „Unser Anspruch ist, dass jede Flasche Wein, die am Esstisch steht, qualitativ herausragend ist.“ Dazu ist sich Stefan Krispel im Klaren, der Natur etwas zurückgeben zu müssen: „Ein Teilbetrieb ist auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, den Rest bewirtschaften wir zertifiziert nachhaltig. Egal ob ein Zertifikat vorliegt oder nicht, jeder Landwirt, der nicht auf seinen Boden achtet, wird langfristig Probleme haben.“
Für Florian Masser ist es wichtig, dass alles im Wandel bleibt: „Wir setzen uns jährlich mit unserem Sortiment auseinander und haben z.B. im letzten Jahr einige Weine aus der Liste genommen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Wir arbeiten auf einem Teil des Weinguts mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten biologisch. Der Rest ist in Planung und wird in den nächsten Jahren folgen.“ Gernot Heinrich ist ein Pionier bezüglich biodynamischer Weine: „Wir schaffen die größtmögliche Biodiversität in den Weingärten. Im Keller intervenieren wir minimal, so erreichen wir einfach mehr Aussagekraft und Individualität, die Weine werden lebendiger und spannender.“
Tom Dockners Weingärten sind mit dem Jahrgang 2025 Bio-zertifiziert: „Wir stellen unseren Betrieb seit 15 Jahren Stück für Stück um. Ich bin überzeugt von dieser Bewirtschaftungsweise, lebendige und gesunde Böden zu bewahren. Genauso die Reben, die darauf wachsen. Das bringt einzigartige Trauben hervor.“ Schlussendlich ist es eine Sache der Qualität, die sich am Ende des Tages durchsetzt, weiß Thomas Taubenschuss zu berichten: „Sehr viel Anklang finden verschiedene, hochwertige, flaschenvergorene Schaumweine, die wir seit den letzten Jahren in 100%iger Eigenregie und aufwendiger Handarbeit herstellen.“
Walter Frauwallner fokussiert ebenso Schaumweine und Klassiker: „Bei den Schaumweinen spüren wir seit Jahren einen Aufschwung im Regionalen, da war zwischenzeitlich gefühlt alles aus dem Ausland. Bei uns sind es die Burgunderrebsorten – Weißburgunder, Grauburgunder und Morillon – sowie Sauvignon Blanc und Gelber Muskateller. Da konnten wir über viele Jahre gleichmäßig hohe Qualität liefern und Vertrauen aufbauen – diese Weine werden mit großer Vorfreude gekauft.“
Gregor Nimmervoll hebt hier die autochthonen Rebsorten hervor: „Die Wiedergeburt des Roten Veltliners am Wagram ist das beste Beispiel dafür. Wir befinden uns aktuell in der Umstellung auf biologisch-organische Wirtschaftsweise. Die Zukunft liegt für uns in nachhaltiger Produktion!“
Reinhold Krutzler befindet sich ebenso in der BIO-Umstellphase. Außerdem fokussiert er die anspruchsvolleren Weine in seinem Sortiment. „Wir verfolgen leichtere, elegantere Stilistiken und entfernen uns vom neuen Holz. Unsere DAC Eisenberg Rebsorten und das Terroir sollen die Geschichte erzählen, auch den Jahrgang hervorheben.“ Dazu ist Michael Schwarz dankbar, dass sich in den letzten Jahren ein Qualitätsmarkt auf einem wirklich hohen Level entwickelt hat: „Wir sind sehr froh, in einem Wohlstandsland wie Österreich und dem dazugehörenden Markt unseren hochwertigen Wein anbieten zu dürfen“
Dazu sollte der Wein auch eine gewisse Finesse haben, weiß der überzeugte Bio-Winzer Markus Huber zu berichten: „Im Allgemeinen werden trockene, fruchtbetonte Weine mit Frische und Eleganz gerne getrunken. Wir produzieren seit jeher diese Weinstilistik.“ Das Weingut Taubenschuss ist seit dem Jahrgang 2023 Bio-zertifiziert und betreibt Kreislaufwirtschaft: „Wir produzieren unseren eigenen Kompost und mit einem Pyrolyseofen sogar unsere eigene Schwarzkohle aus den alten Rebstöcken und ausschließlich damit werden unsere Weingärten gedüngt.“
Philipp Grassl sieht die Chancen im hochqualitativen Bereich, mit einem Trend zum Weißwein, aber die roten Klassiker sind im Export noch immer sehr beliebt. Dazu sollte man erwähnen, dass Grassl seit 2019 biodynamisch arbeitet: „Gerade der holistische Ansatz im Biodynamischen gefällt uns sehr gut, aber wir sehen das nicht dogmatisch, sondern pragmatisch, für mich ist es ein top-up auf unserer Bewirtschaftung, zum Beispiel die eigene Kompostwirtschaft zeigt schon mal den riesigen Unterschied in der Qualität der Dünger.“
Auf die richtige Mischung kommt es an…
Der Qualitätswinzer René Pöckl bewirtschaftet keine biologisch zertifizierte Weingärten: „Wir versuchen aus beiden Ansätzen, Bio und konventionell, das Beste herauszuholen. Am Beginn des Jahres arbeiten wir biologisch, jedoch verwenden wir in schwierigen Jahren ‚Schulmedizin‘. Insektizide und Herbizide wurden von uns nie verwendet.“
Hannes Dreisiebner arbeitet im Weinberg konventionell: „Die Gründe liegen auf der Hand: Die Südsteiermark ist ein kühles, niederschlagsreiches Weinanbaugebiet. Das führt im Bioweinbau zu geringeren Erträgen und zur wirtschaftlichen Unsicherheit. Die Zukunft im Pflanzenschutz könnte eine Mischvariante aus konventionell und biologisch werden. Unter dem Motto, warum zum Arzt gehen, wenn ich nicht krank bin, bzw. warum keine wirksame Behandlung erlauben, wenn ich Hilfe benötige.“ Florian Dillinger verzichtet bereits seit 2015 auf Herbizid und Insektizid und einiges mehr: „Wir machen unseren eigenen Kompost und bringen ihn wieder in den Weingärten aus. Bio ist für uns wegen dem vielen Niederschlag und den Steillagen derzeit (noch) kein Thema, wir sind aber gut informiert und beobachten die Entwicklung.“
Die Weichen für die Zukunft stellen…
„Für frühere Lesezeitpunkte, andere Rebschnitt-Techniken, Anpassungen bei der Laubarbeit und Bodenbearbeitung oder auch technische Lösungen, wie zum Beispiel Hagelnetze“, spricht sich Chris Yorke aus, wenn es um die Zukunft geht. „So etwas ist aber immer auch mit einem Kostenaufwand verbunden, den ein Betrieb stemmen muss.“
„Man muss sehr individuell auf die Sorten und Lagen eingehen und viel Handarbeit leisten, um die Trauben beispielsweise vor zu viel Sonne zu schützen“, weiß Stefan Krispel aus eigener Erfahrung zu berichten. „Man muss als Winzer natürlich auch davon ausgehen, dass es große Mengenschwankungen im Jahrgang gibt, und daher streben wir auch eine längere Lagerung im Keller an, um so eventuelle kleine Ernten ausgleichen zu können“, so der Südoststeirer.
Florian Masser denkt nicht nur über andere Weinsorten nach, er pflanzt sie bereits an: „Wir werden bei unseren Weingärten natürlich weiterhin auf PiWis setzen, damit wir gerade schattige Stücke, oft in Waldnähe, besser gegen Pilzkrankheiten schützen können.“ Für Gernot Heinrich steht die Schonung der Natur im Vordergrund. „Wir müssen unsere Böden verlebendigen, sprich Humus aufbauen und so Kohlenstoff in den Boden zu bringen.“
Reinhold Krutzler versucht ein Gleichgewicht im Weingarten zu halten: „Durch die Begrünung geht weniger Humus verloren, so kann das Wasser gespeichert werden und ist für die Pflanzen verfügbar.“ Dazu hat man am Eisenberg weder Grundwasser, noch einen nahen See oder Fluss zur Verfügung: „Unsere Rebe ist tief verwurzelt, spürt das nicht gleich, optimal ist das nicht, extrem heiße Sommer und sehr trockene Winter sind da jetzt nicht gut.“ Für Michael Schwarz war das Jahr 2024 voller Herausforderungen: „Aufgrund von diversen Ausfällen im Weingarten gab es weniger Trauben. Wir leben und arbeiten mit der Natur und können sie auch nicht beeinflussen. Wichtig ist nur, sich anzupassen und zu lernen.“ Philipp Grassl sieht das Weingartenmanagement gefordert: „Man weicht auf kühlere Lagen aus und natürlich finden auch neue Sorten den Weg in unsere Weingärten, heuer werden die ersten Trauben von Cabernet Franc und Furmint geerntet.“
Hannes Dreisiebner nimmt’s sportlich: „Der Umgang mit schwierigen Witterungsbedingungen gehört zu unserem Beruf dazu. Seit 1994 sind die extremsten Jahre und schwierigsten Ernten folgende: 2003 Hitze und Trockenheit, 2009 Hagel, 2014 Regen und 2016 Frost. Aber die letzten 8 Ernten waren in der Südsteiermark sicherlich die besten 8 Jahrgänge am Stück, seit unsere Familie hier am Hof Weinbau betreibt. Ein Risiko gab es immer schon und wird es immer geben.“ Thomas Taubenschuss profitiert vom hohen Durchschnittsalter seiner Rebstöcke: „Wir bewässern nicht, sondern profitieren vom ausgeprägten Wurzelwerk und der Erfahrung. Auch andere Sorten, wie PiWi, sind nicht unbedingt die Lösung, sondern eher das Begrünungsmanagement und die Bewirtschaftungsweise der Weingärten.“
Tom Dockner denkt für zukünftige Ernten über Hagelschutznetze und eine Bewässerung sehr trockener Standorte nach, dazu kultiviert er neue Lagen: „Eine kühlere Lage, die Ried Theyerner Berg um unser Weingut herum, rekultivieren wir seit 2009 und zeigt beste Ergebnisse!“ Florian Dillinger zieht nach Möglichkeit ebenfalls kühlere Lagen vor: „So kann man die Reife etwas verzögern. Bei den einzelnen Sorten setzen wir auf andere Unterlagen, die zum Beispiel trockenheitsresistenter als andere sind.“ Walter Frauwallner hat bereits zwei Drittel seiner Weingärten mit Hagelnetzen umgeben und 2024 zwei Nächte mit Frostschutzkerzen geheizt. „Dadurch haben wir auch gute Erträge mit sehr guten Qualitäten gehabt. Es war ein Jahrgang für die Leser! Wunderschöne Trauben, nahezu null zum Putzen, hat allen Lesern richtig Spaß gemacht.“
Text: Martin G. Wanko